Freitag, 3. April 2009
Manchester, du wirfst so viele Fragen auf
elephant, 20:31h
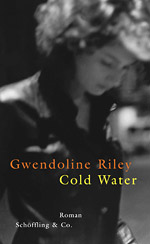
„Wir lagen zusammen im Gras und tranken fertig gemixten Martini mit Limonade aus dem Spar-Laden. Wir blödelten herum, eben wie Leute, die verliebt sind oder so. Ich legte meinen Unterarm neben seinen und sagte: ‚Das ist Manchesterbräune.’“ Cold Water ist der Debütroman von Gwendoline Riley und der junge Mann, neben dem die Erzählerin Carmel hier im Gras liegt, ist ihr Freund Tony. In kurzen Kapiteln und kurzen Sätzen erzählt Cold Water den Alltag von Carmel, einer jungen Frau, die mit 20 an der Theke einer Bar in Manchester arbeitet, noch keine festen Pläne für das Leben jenseits des nächsten Wochenendes hat, viel liest, nachdenkt und trinkt. Die Gäste der Bar, in der sie arbeitet, sind dabei ebenso Episoden des Romans wie Spaziergänge durch das nächtliche Manchester, trostlose Geburtstagsfeiern ebenso trostloser Bekanntschaften und schließlich ihre Beziehung zu Tony, dem Musiker, dessen Bandproben sie mit einer Flasche Schnaps im Arm und ihrer Freundin neben sich auf der alten, gammligen Couch einer Fabrikhalle verbringt. In Carmels Alltag passiert nicht viel, aber im Gegensatz zu vielen schreibschulgeprägten Texten, denen gerade diese Erfahrungs- und Handlungsarmut zum Vorwurf gemacht wird, trifft Cold Water gerade durch die Thematisierung grauer Alltagsleere ins Mark dessen, was das Heranwachsen in einer englischen Arbeiterstadt wie Manchester vermutlich ausmacht. Und auch wenn Gwendoline Riley eine ganze Reihe von Kriterien erfüllt, um in die Kategorie junge, erfolgreiche, gut aussehende Autorin zu fallen, so entzieht sich Cold Water ebendieser Kategorie doch immer wieder erfolgreich.
Dass das so ist, hat der Roman besonders seiner Erzählerin zu verdanken. Riley hat Carmel eine Stimme verliehen, die mit schwarzem Humor und einer ordentlichen Portion Coolness den Seinszustand mit Anfang 20 trefflich einfängt. Am stärksten ist Cold Water allerdings immer dann, wenn es um Manchester geht. „Ich bin in Manchester, und ich verdiene nicht genug, um jetzt schon wegzugehen“, sagt Carmel: „Vorläufig sind hier meine Grenzen: die sternförmig hinaus zu den Landstraßen führenden Buslinien; dünn besiedelte, von heruntergekommenen Pubs und Einkaufszentren gesäumte Strecken. Exakt gleich gen Norden, Süden, Osten, Westen.“
Carmel McKisko ist nicht Holden Caulfield und Manchester ist nicht New York. Dass J.D. Salinger einer der Lieblingsautoren von Gwendoline Riley ist, merkt man ihrem Debüt aber durchaus an. Dazu passt auch, dass in Rileys folgendem Roman Sick Notes der Satz fällt: „New York’s just like Manchester, o nly it’s taller.“ Als stilprägendes Vorbild nennt Riley neben Salinger auch Morrisey, Sänger der legendären Band aus Manchester The Smiths. „Manchester, so much to answer for“, sang Morrisey in den 80er Jahren. In Cold Water erfährt diese Zeile einen gelungenen Nachhall, der auch in der deutschen Übersetzung nicht an sprachlicher Kraft einbüßt und gerade durch die Glaubwürdigkeit und Intensität seiner Protagonistin besticht.
In Deutschland ist Cold Water mit einiger Verspätung auf den Markt gekommen. Die Band, die vermutlich als Romanvorlage diente, hat sich mittlerweile als Maximo Park international einen Namen gemacht. 2008 hat Riley für ihren dritten Roman Joshua Spassky, der in den USA spielt, mehrere Literaturpreise verliehen bekommen. Im Februar 2009 wird nun ihr zweiter Roman unter dem Titel Krankmeldungen in deutscher Übersetzung erscheinen, für die Wartezeit bis dahin gibt es zum Glück Cold Water.
Simone Schröder
Gwendoline Riley: Cold Water. Roman. Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier. Schöffling & Co. 2008. 160 Seiten. 17,90 Euro.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 23. Juni 2008
"Exil im Niemandsland" von Roberto Bolaño
elephant, 16:11h
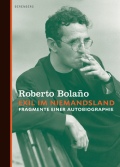
Unter den lateinamerikanischen Autoren der ersten Generation nach dem Boom – nach Garcia Marquez, Vargas Llosa, Cortazar und Fuentes – ist in Europa niemandem, abgesehen vielleicht von Isabel Allende, ähnliche Beachtung zuteil geworden wie Roberto Bolaño. In Chile geboren, lebte er bis zu seinem frühen Tod 2003 in allen möglichen Ländern. Bekannt wurde er mit Die Naziliteratur in Amerika, einem pseudoenzyklopädischen Werk über sämtlich fiktive Autoren und deren Werke.
Der Schriftsteller im Exil – über dieses Phänomen konnte Bolaño aus eigener Erfahrung schreiben, und das tut er in einigen der hier versammelten Texte, jedoch nicht ohne zu betonen, dass er „das, was man gemeinhin Exil nennt“ – nicht ganz freiwillig in einem fremden Land zu leben – „in Wahrheit nicht als solches empfand.“ Bolaños eigentliche Emigration begann lange bevor er aus Chile wegging, als er begriff, dass er die ganze Welt kennen lernen konnte, ohne seine vier Wände zu verlassen, und zwar, indem er immer wieder seinen „eigenen Rekord der an einem Tag gelesenen Seiten“ schlug, wie es in Erinnerungen an Los Ángeles heißt „Wahrscheinlich beginnt für uns Schriftsteller und Leser eine bestimmte Art von Exil, wenn wir die Kindheit hinter uns lassen“ erklärt er, und: „Die Heimat des wahren Schriftstellers ist seine Bibliothek, die aus Regalen oder aus seinem Gedächtnis besteht.“
Sie ist das Niemandsland, von dem im Titel die Rede ist, und sie ist das wahre Thema dieser nun in einem schmalen Band versammelten Texte, die als Fragmente einer Autobiographie – so der Untertitel – Mosaiksteine zu einem Selbstportrait dieses Schriftstellers abgeben.
Bei vielen der Texte handelt es sich um Auftragsarbeiten, die Bolaño für Zeitungen verfasste oder für Kongresse, zu denen er eingeladen war. Es sind Reden, Reisebilder, Essays und ein Interview, entstanden in den letzten Jahren seines Lebens, während derer er sich in dem spanischen Städtchen Blanes niedergelassen hatte. Hier hatte er eine Art Wahlheimat in der Wirklichkeit gefunden, die ihm zuerst in einem Roman Juan Marses begegnet war, so dass Bolaño, wenn er über Blanes schreibt, eigentlich einen literarischen Ort im Kopf hat.
Ähnlich verhält es sich mit Patagonien und auch mit Berlin. Bolaño erzählt, wie er dorthin zu einer Lesung eingeladen war. „Ich war in einem riesigen Herrenhaus am Wannsee untergebracht, dem See in einem Vorort Berlins, wo sich Heinrich von Kleist 1811 das Leben nahm zusammen mit der bedauernswerten Henriette Vogel, die tatsächlich wie ein Vogel war, aber ein hässlicher, stiller Vogel, einer jener Vögel, die ohne die Flügel ausbreiten zu müssen, an den Pforten zur Finsternis, zum Unbekannten sitzen. Ich hielt mich damals für jemanden, der mit Kleist nicht viel zu tun hatte.“ Doch in den frühen Morgenstunden meint er, vom Fenster seines Zimmers Kleists Geist am Ufer des Sees zu erblicken. So wie hier gleitet in diesen Prosastücken immer wieder der sachliche Ton, in dem sie beginnen, ins Literarische hinüber, verwandelt sich die Realität ins Phantastische.
Darin liegt eine Faszination des Buches: Es enthält nichtfiktionale Prosa und doch ist sein Wahrheitsgehalt ungewiss, erscheint die Wirklichkeit oft überreal. Auch der Autor selbst wird zu einer literarischen Figur und hält Zwiesprache mit anderen Dichtern, mit Klassikern genauso wie mit Unbekannten und Vergessenen, dem Lyriker Rodrigo Lira etwa, „der wie so viele andere lateinamerikanische Dichter starb, ohne etwas veröffentlicht zu haben“, und von dem Bolaño dennoch zu glauben versucht ist, „er sei der letzte Dichter Chiles gewesen, einer der letzen Dichter Lateinamerikas.“ Von dem griechischen Dichter Archilochos, der im siebten vorchristlichen Jahrhundert lebte, über Lichtenberg und Swift bis zu Borges und Philip K. Dick reicht die Galerie der Autoren, die Bolaño zitiert und über die er als Leser schreibt, nicht als Kritiker.
Die Texte spiegeln Bolaños eigene Leseerfahrungen wieder, Bücher verbinden sich mit Orten, Situationen und Eindrücken. „Die Bücher, an die ich mich am besten erinnern kann, sind die, die ich im Alter zwischen sechzehn und neunzehn Jahren in den Buchhandlungen der mexikanischen Hauptstadt geklaut und diejenigen, die ich während der Tage vor und nach dem Putsch in Chile gekauft habe, als ich zwanzig Jahre alt war“ bekennt er in Wer traut sich. In Spaziergang durch die Literatur begegnet er abschließend vielen Autoren, die er bewundert und gekannt hat, noch einmal im Traum, oder besser gesagt: in auf wenige Sätze zusammengedrängten Traumbeschreibungen. „Mir träumte, ich sei fünfzehn Jahre alt und auf dem Weg zu Nicanor Parra, um mich zu verabschieden. Ich fand ihn aufrecht gegen eine schwarze Wand gelehnt. Wo gehst du hin, Bolaño?, fragte er. Weit weg aus dem Süden, erwiderte ich.“
von Andreas Martin Widmann
--------------------------------------------------------------------------------
Roberto Bolaño: Exil im Niemandsland.
Fragmente einer Autobiogrphie
Tres, 2000. Entre paréntesis, 2004
Aus dem Spanischen von Kirsten Brandt u. Heinrich v. Berenberg.
Berenberg Verlag, Berlin 2008
160 S. EUR 19,90
ISBN 978-3-937834-26-9
... link (0 Kommentare) ... comment
Ein anderes Alaska - Michael Chabons "Die Vereinigung jidischer Polizisten"
elephant, 16:09h
„Seit neun Monaten haust Landsman nun im Hotel Zamenhof, ohne dass es einem seiner Mitbewohner gelungen wäre, sich umbringen zu lassen. Jetzt hat jemand dem Gast von Zimmer 208 eine Kugel in den Kopf gejagt, einem Jid, der sich Emanuel Lasker nannte.“ Für den Polizisten Meyer Landsman, der in Zimmer 505 lebt, bedeutet dieser Mord drei Stockwerke tiefer eine willkommene Abwechslung in seiner dienstfreien Zeit, die er seit seiner Scheidung üblicherweise schlafend und trinkend zubringt. Doch kaum hat ihn das Verbrechen aus seiner Lethargie gerissen, überschlagen sich die Ereignisse für Landsman, seinen Kollegen und Kumpel Berko und für seine Ex-Frau Bina Gelbfish, die seit kurzem Landsmans Vorgesetzte ist. Nachdem die Identität des Toten geklärt ist, häufen sich die Hinweise darauf, dass dieser – Mendel Shpilman, Sohn eines chassidischen Lehrers – vor seinem Absturz in die Heroinsucht nicht nur als außergewöhnlich talentierter Schachspieler von sich reden gemacht hat, sondern sogar als ein neuer Messias verehrt worden ist. Schon bald gibt es noch mehr Tote und weil einige davon auf Landsmans Rechnung gehen, wird ihm sein Dienstausweis entzogen. Das einzige, was ihm bleibt, ist seine abgegriffene Mitgliedskarte der Vereinigung jiddischer Polizisten und so nimmt er auf eigene Faust die Spur des Verbrechens auf, die ihn weiter in den Norden Alaskas führt. Dort war Shpilman kurz Patient einer Entzugsklinik, dort werden Kühe mit seltsamem Fell gezüchtet und auch das Personal des obskuren Sanatoriums erweist sich als äußerst schlagkräftig.
„1948: seltsame Zeiten für Juden. Im August brach die Verteidigung von Jerusalem zusammen, und die zahlenmäßig unterlegenen Juden der drei Monate alten Republik Israel wurden verjagt, massakriert, ins Meer getrieben.“ Selbst wer den Verweis auf einen Veteranen des Kubakriegs auf der ersten Seite des Romans übersehen hat, reibt sich wohl an dieser Stelle die Augen, bevor er ein paar Sätze weiter liest, dass die 1948 aus Israel vertriebenen Juden eine auf sechzig Jahre befristete Siedlungslizenz in einem Teil Alaskas erhielten. Damit ist klar, dass die politische Landkarte, die Chabon in seinem Roman zeichnet, deutlich von der Erfahrungswirklichkeit der Leser abweicht. Die Geschichtswissenschaft bezeichnet entsprechende Gedankengebäude als kontrafaktische Überlegungen. Spätestens seit Robert Harris’ Bestseller Vaterland, in dem eine Welt, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, den Hintergrund für eine Kriminalhandlung abgibt, haben solche kontrafaktischen Geschichtsdarstellungen besonders in der populären Literatur Konjunktur.
Kontrafaktische Vision und faszinierendes Spiel mit literarischen Vorlagen
Chabon macht für die Erzählhandlung seines Romans eine historische Fußnote zum Aufhänger: Den 1938 von dem amerikanischen Politiker Harold Ickes eingebrachten Vorschlag, Alaska als rettenden Hafen für europäische Juden zu öffnen. Aus der fiktiven historischen Weichenstellung ergibt sich in Chabons Roman ein alternativer Geschichtsverlauf, innerhalb dessen der Zweite Weltkrieg erst 1946 endet, und zwar mit der Zerstörung Berlins durch nukleare Waffen. Was Die Vereinigung jiddischer Polizisten von trivialeren Produkten des Genres abhebt, ist zunächst die Art und Weise, in der die Kriminalhandlung auf den kontrafaktischen historischen Hintergrund bezogen ist, denn der Mordfall und das Schicksal der Juden in Alaska hängen enger zusammen als Landsman und der Leser anfangs ahnen können. Und so erscheint im Falle von Die Vereinigung jiddischer Polizisten der Vergleich mit Philip Roth näher liegend als der mit Robert Harris, denn auch Roths Verschwörung gegen Amerika machte unlängst das Schicksal der Juden unter veränderten historischen Umständen zum Thema eines Romans. Den Anstoß zu Die Vereinigung jiddischer Polizisten gaben Chabon die Reaktionen auf einen Essay, den er unter dem Titel A Guidebook to a Land of Ghosts über einen jiddischen Reisesprachführer aus dem Jahr 1958 geschrieben hatte. In welchem Land der Welt, so Chabons Frage, könne ein solches Buch seinen Zweck erfüllen, nachdem Israel ein und für allemal dem Jiddischen den Rücken gekehrt und die Sprecher dieser Sprache zu einer aussterbenden Spezies geworden seien? Seine traurige und pessimistische Diagnose trug ihm zahlreiche Vorwürfe ein und rief mit seinem Roman wiederum eine literarische Antwort hervor. Dieser entwirft eine eigene Version eines solchen Landes, doch das von Chabon geschilderte Alaska, in dem Jiddisch Amts- und Umgangssprache ist, ist keine zionistische Utopie, sondern ein Provisorium, dessen Verfallsdatum zum Greifen nahe ist. Und so lässt sich Chabons Werk auch als fiktionale Interpretation eines historischen Sachverhalts und als Kommentar zur nicht enden wollenden Debatte um das Existenzrecht Israels lesen.
Bei alledem ist Die Vereinigung jiddischer Polizisten jedoch auch ein faszinierendes Spiel mit unzähligen Motiven und literarischen Vorlagen. Chabons Ermittlerfigur ist ein hard-boiled detective, in der Tradition Dashiell Hammetts und Raymond Chandlers stehend, und auch sprachlich sind die Reminiszenzen an Chandler unverkennbar. Eine Figur wird vorgestellt als „ein riesiges auseinandergelaufenes Dessert, ein Comichaus mit geschlossenen Fenstern, in dem der Wasserhahn aufgedreht wurde“, eine andere trägt „eine Brille, wie sie alternde britische Rockgitarristen gerne in nachdenklichen Interviews zur Schau stellen“. Zusammen mit den jiddischen Einsprengseln entwickelt sich so ein eigener Erzählton, ein Strom aus kunstvollen Wortbildern, der den Leser durch das Buch trägt – durch ein Buch, dessen Handlung immer wieder von Neuem überraschen kann und das sich in einem Tag und einer Nacht herunterlesen lässt, ohne dass nachher ein schales Gefühl zurückbliebe.
von Andreas Martin Widmann
--------------------------------------------------------------------------------
Michael Chabon: Die Vereinigung jiddischer Polizisten (The Yiddish Policemen’s Union, 2007) Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer. Kiepenheuer & Witsch 2008. 422 Seiten. 19,95 Euro.
„1948: seltsame Zeiten für Juden. Im August brach die Verteidigung von Jerusalem zusammen, und die zahlenmäßig unterlegenen Juden der drei Monate alten Republik Israel wurden verjagt, massakriert, ins Meer getrieben.“ Selbst wer den Verweis auf einen Veteranen des Kubakriegs auf der ersten Seite des Romans übersehen hat, reibt sich wohl an dieser Stelle die Augen, bevor er ein paar Sätze weiter liest, dass die 1948 aus Israel vertriebenen Juden eine auf sechzig Jahre befristete Siedlungslizenz in einem Teil Alaskas erhielten. Damit ist klar, dass die politische Landkarte, die Chabon in seinem Roman zeichnet, deutlich von der Erfahrungswirklichkeit der Leser abweicht. Die Geschichtswissenschaft bezeichnet entsprechende Gedankengebäude als kontrafaktische Überlegungen. Spätestens seit Robert Harris’ Bestseller Vaterland, in dem eine Welt, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, den Hintergrund für eine Kriminalhandlung abgibt, haben solche kontrafaktischen Geschichtsdarstellungen besonders in der populären Literatur Konjunktur.
Kontrafaktische Vision und faszinierendes Spiel mit literarischen Vorlagen
Chabon macht für die Erzählhandlung seines Romans eine historische Fußnote zum Aufhänger: Den 1938 von dem amerikanischen Politiker Harold Ickes eingebrachten Vorschlag, Alaska als rettenden Hafen für europäische Juden zu öffnen. Aus der fiktiven historischen Weichenstellung ergibt sich in Chabons Roman ein alternativer Geschichtsverlauf, innerhalb dessen der Zweite Weltkrieg erst 1946 endet, und zwar mit der Zerstörung Berlins durch nukleare Waffen. Was Die Vereinigung jiddischer Polizisten von trivialeren Produkten des Genres abhebt, ist zunächst die Art und Weise, in der die Kriminalhandlung auf den kontrafaktischen historischen Hintergrund bezogen ist, denn der Mordfall und das Schicksal der Juden in Alaska hängen enger zusammen als Landsman und der Leser anfangs ahnen können. Und so erscheint im Falle von Die Vereinigung jiddischer Polizisten der Vergleich mit Philip Roth näher liegend als der mit Robert Harris, denn auch Roths Verschwörung gegen Amerika machte unlängst das Schicksal der Juden unter veränderten historischen Umständen zum Thema eines Romans. Den Anstoß zu Die Vereinigung jiddischer Polizisten gaben Chabon die Reaktionen auf einen Essay, den er unter dem Titel A Guidebook to a Land of Ghosts über einen jiddischen Reisesprachführer aus dem Jahr 1958 geschrieben hatte. In welchem Land der Welt, so Chabons Frage, könne ein solches Buch seinen Zweck erfüllen, nachdem Israel ein und für allemal dem Jiddischen den Rücken gekehrt und die Sprecher dieser Sprache zu einer aussterbenden Spezies geworden seien? Seine traurige und pessimistische Diagnose trug ihm zahlreiche Vorwürfe ein und rief mit seinem Roman wiederum eine literarische Antwort hervor. Dieser entwirft eine eigene Version eines solchen Landes, doch das von Chabon geschilderte Alaska, in dem Jiddisch Amts- und Umgangssprache ist, ist keine zionistische Utopie, sondern ein Provisorium, dessen Verfallsdatum zum Greifen nahe ist. Und so lässt sich Chabons Werk auch als fiktionale Interpretation eines historischen Sachverhalts und als Kommentar zur nicht enden wollenden Debatte um das Existenzrecht Israels lesen.
Bei alledem ist Die Vereinigung jiddischer Polizisten jedoch auch ein faszinierendes Spiel mit unzähligen Motiven und literarischen Vorlagen. Chabons Ermittlerfigur ist ein hard-boiled detective, in der Tradition Dashiell Hammetts und Raymond Chandlers stehend, und auch sprachlich sind die Reminiszenzen an Chandler unverkennbar. Eine Figur wird vorgestellt als „ein riesiges auseinandergelaufenes Dessert, ein Comichaus mit geschlossenen Fenstern, in dem der Wasserhahn aufgedreht wurde“, eine andere trägt „eine Brille, wie sie alternde britische Rockgitarristen gerne in nachdenklichen Interviews zur Schau stellen“. Zusammen mit den jiddischen Einsprengseln entwickelt sich so ein eigener Erzählton, ein Strom aus kunstvollen Wortbildern, der den Leser durch das Buch trägt – durch ein Buch, dessen Handlung immer wieder von Neuem überraschen kann und das sich in einem Tag und einer Nacht herunterlesen lässt, ohne dass nachher ein schales Gefühl zurückbliebe.
von Andreas Martin Widmann
--------------------------------------------------------------------------------
Michael Chabon: Die Vereinigung jiddischer Polizisten (The Yiddish Policemen’s Union, 2007) Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer. Kiepenheuer & Witsch 2008. 422 Seiten. 19,95 Euro.
... link (0 Kommentare) ... comment
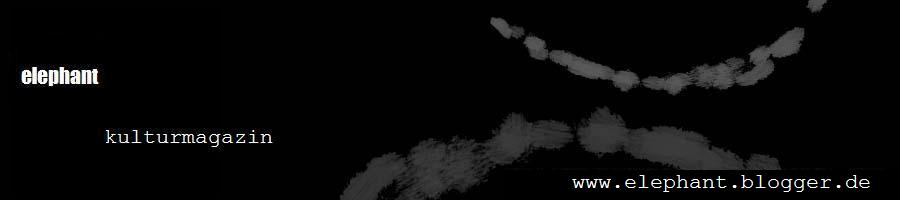 kulturmagazin
kulturmagazin