Montag, 9. März 2009
Dave Eggers. Starautor, Produzent, Unternehmer und Lehrer
elephant, 17:20h
Dave Eggers, dessen frühere Bücher für ihre sprachlichen Gewandtheit und die Frische der adoleszenzphilosophischen Betrachtungen gefeiert wurden, ist nun mit zwei sehr unterschiedlichen Publikationen als Romanautor und als Herausgeber einer Kurzgeschichtensammlung präsent. Eine Annährung an einen engagierten Schriftsteller von Andreas Martin Widmann
Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, werden früher oder später von Journalisten danach gefragt, wie der Name ihrer Band eigentlich zustande gekommen sei. „Wir haben uns nach einem Marmeladenrezept meiner Großmutter benannt“, sagen sie dann. Oder nach einer Gedichtzeile von William Blake. Oder dass sie keine Idee hatten und zehn Minuten vor dem ersten Auftritt auf gut Glück in ein Lexikon geschaut haben. Wichtiger als der Name ist, eine gute Geschichte erzählen zu können. Das gilt erst recht für Literaturzeitschriften. Als er selbst noch ein Kind war, berichtet Dave Eggers, erhielt seine Familie über mehrere Jahre hinweg immer wieder Post von einem Menschen, der schrieb, er sei ein Verwandter, und der in seinen Briefen seinen Besuch ankündigte. Er nannte sich Timothy McSweeney, gekommen ist er nie. Eggers erzählt diese Geschichte im Vorwort zu The Best of McSweeney’s. Als Name für eine Literaturzeitschrift bot sich der ominöse, ungeliebte Verwandte deshalb an, weil das Magazin als eine Art Asyl für Texte geplant war, die an anderer Stelle abgelehnt worden waren. Schon nach dem ersten Heft ging McSweeney’s jedoch dazu über, Originalbeiträge zu publizieren, von Autorinnen und Autoren wie Rick Moody, dem jüngst verstorbenen David Foster Wallace, von William T. Vollmann oder Nicole Krauss.
Die Idee zu McSweeney’s wurde geboren, während Eggers selbst noch an seinem ersten Roman schrieb und, wie er sagt, etwas suchte, um die Arbeit an dem Buch hinauszuschieben. Als es 2000 erschien, wirkte der Titel selbstbewusst, programmatisch und prophetisch: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität machte Eggers in den USA und in Europa auf Anhieb bekannt. Zusätzlich zum Verkaufserfolg brachte dieses Werk dem damals dreißigjährigen Autor auch eine Nominierung für den Pulitzerpreis ein. Eggers erzählt darin vom Tod seiner Eltern, die beide innerhalb weniger Wochen an Krebs starben, wie er selbst die Erziehung seines acht Jahre alten Bruders Toph übernahm und von den Jahren, in denen die beiden gemeinsam in Chicago, Kalifornien und New York lebten. Obschon die Erlebnisse fiktional überformt sind, trieb Eggers den Gestus des Autobiografischen so weit, dass er in der ersten Ausgabe Telefonnummern seiner Freunde abdrucken ließ. Entsprechend wurde das Buch von vielen nicht als Roman aufgenommen, sondern als Memoirenbuch. Den Anstrich des Authentischen und die damit einhergehende Rezeption karikiert jedoch das Foto des Autors auf einer der ersten Seiten. Eine leicht unscharfe Aufnahme zeigt einen jungen, dunkelhaarigen Mann in einem weißen T-Shirt. Auf seiner rechten Schulter sitzt ein Vogel, zwei Hundeköpfe flankieren ihn. Darunter ein paar Sätze zu seinem Leben, zuletzt heißt es, Eggers lebe mit seinem Bruder in Kalifornien und sie hätten keine Haustiere – der Leser soll bloß kein falsches Bild des Autorerzählers bekommen.
Das literarische Dokument einer Selbstfindung
Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität ist eine Coming-of-Age-Geschichte, das literarische Dokument einer Selbstfindung im Amerika der 1990er-Jahre und mit seiner exponierten Durchschnittsauthentizität nicht zuletzt ein Pendant zur MTV-Show „The Real World“, für die Eggers und die Mitarbeiter seiner ersten Independent-Zeitschrift Might sich ohne Erfolg bewarben. In den Nachwehen der literarischen Postmoderne hatte der Roman dabei eine neue, nicht artifiziell-vertrackte, sondern frische kompositorische Verspieltheit. Dort, wo das Kleingedruckte steht, das normalerweise kein Mensch liest, zwischen ISBN und Copyright-Erklärung, finden sich noch ein paar Angaben zum Verfasser sowie eine Skala zur Bestimmung seiner sexuellen Orientierung. Zwischen 1 für absolut hetero und 10 für absolut schwul stuft Eggers sich als 3 ein. Der eigentlichen Erzählung vorangestellt sind unter anderem eine unvollständige Liste mit Personen und Metaphern und ein langer Prolog, in dem Eggers Ratschläge für den Lektüregenuss des folgenden Werkes erteilt und auch Passagen nennt, die der Leser überspringen könne, ohne dadurch den Anschluss zu verlieren. Als Anhang präsentiert Eggers in der Taschenbuchausgabe noch einmal rund 50 Seiten mit gestrichenen Passagen, Korrekturen und allem Möglichen. Um diese zusätzlichen Passagen lesen zu können, muss man das Buch umdrehen, die Seiten sind – von vorne gesehen – auf dem Kopf stehend gedruckt.
In seinem nächsten Roman trieb Eggers dieses Spiel mit Möglichkeiten zur Erweiterung und Durchbrechung des Erzähltexts jedoch nicht noch weiter. Zwar beginnt Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind schon auf dem Buchdeckel, rein formal ist es im Vergleich mit dem Erstling dennoch fast konventionell. Im ersten Satz teilt der Erzähler mit, alles was folgt, hat sich ereignet, nachdem sein Freund Jack ums Leben kam und bevor er selbst mit 42 anderen Menschen, die er noch nicht kannte, in Kolumbien ertrank. Bei allen Mitteln, mit denen sich das Buch möglichen Genrezuordnungen widersetzt, ließe es sich doch als globale road novel bezeichnen. Um einmal rund um die Welt zu reisen, bleiben dem Ich-Erzähler Will Chmlielewski und seinem Begleiter Hand nur eine Woche. Anlass für dieses Unternehmen ist ein Haufen Geld – 32.000 Dollar, um genau zu sein –, die Will dafür erhalten hat, dass er für ein Glühbirnenwerbelogo Model gestanden hat und die er auf jeden Fall wieder loswerden will. Innerhalb von nur einer Woche fliegen die beiden deshalb in Zick-Zack-Routen um den Erdball, dabei einem eigenen Codex des Nicht-Umkehren-Dürfens folgend, und bringen amerikanische Dollars unter die Leute. Statt das Geld zu spenden oder auf profane Weise zu verschenken, kleben sie es mit Paketband an grasende Ziegen in Afrika. Der Zufall soll bestimmen, wem es zugute kommt, so wie Jacks Tod nichts weiter war als ein Zufall. Wie schon in Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität mischen sich der Tod und die Trauer immer wieder zwischen die komischen Episoden. Wills Aufbruch ist auch eine Flucht, weniger vor einem Ort oder einem Land als vor seinen eigenen Erinnerungen, vor den Gedanken an den Tod seines Freundes Jack, der in seinem Auto von einem Lastwagen überrollt worden ist.
Der einhellige Enthusiasmus, mit dem das erste Buch begrüßt wurde, konnte oder sollte sich nicht noch einmal einstellen. Galt die Detailversessenheit im ersten Buch als Beleg für Eggers Talent, Nichtigkeiten allein dank seiner stilistischen Brillanz zu literarischen Juwelen umschreiben zu können, wurde sie ihm nun als unnötig und nervtötend vorgehalten. Dabei war es nahe liegend, den Titel des ersten Romans aufzugreifen und zu konstatieren, Eggers sei dieses Mal weder genial noch umwerfend. Die Titel animieren aber nicht nur Rezensenten zu mancher euphorischen oder hämischen Bemerkung, sie sind überdies auch kaum übertragbar. Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius) hört sich an, als hätte das ein Dolmetschcomputer ausgespuckt, und auch Ihr werdet (noch) merken wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity) ist zwar auch weitgehend korrekt, klingt aber nicht sehr cool. Offenbar hat der deutsche Verlag es aufgegeben, nach wörtlichen Übersetzungen für sie zu suchen. Für die beiden in diesem Jahr zeitgleich erschienenen Bände hat man sich dagegen darauf besonnen, was im Kino üblicherweise gemacht wird: gar keine Übersetzung oder ein ganz anderer Titel. Es blieb bei The Best of McSweeney’s und What Is the What heißt auf Deutsch Weit gegangen.
Der Roman als Teil eines humanitären Projekts
Handlung des Romans ist das nicht unangemessen. Auf mehr als 700 Seiten erzählt Eggers die wahre Geschichte von Valentino Achak Deng, eines sudanesischen Flüchtlings, der nach einer traumatisierenden Odyssee in die USA gelangt ist. Mit diesem dritten Roman wendet sich Eggers zugleich der oral history zu, die in der afroamerikanischen Literatur durch die slave narratives eine wichtige Tradition hat. Führte im 19. Jahrhundert noch für viele Schwarze der Weg von Afrika nach Amerika in die Sklaverei, so sind die USA für Achak Deng und viele seiner Landsleute das Land, in dem sie Asyl, aber keine Heimat finden. „Ich kam hierher, viertausend von uns kamen hierher, und wir erhofften und erwarteten Ruhe. Frieden, eine Ausbildung und Sicherheit.“ Diese Erwartungen werden enttäuscht, statt aufs College zu gehen, muss Deng Aushilfsjobs annehmen. Die Flüchtlinge leben als Schatten in dieser Gesellschaft und es fehlt ihnen eine Stimme, die ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung Gehör verschafft. Dave Eggers hat deshalb seine eigene angeboten. So ist seine Erzählung des Lebens des Valentino Achak Deng auch ein Roman. Das Buch solle daher „nicht als verbindliche Geschichte des Bürgerkriegs im Sudan oder des sudanesischen Volkes verstanden werden, nicht mal als die meiner Brüder, die man als die Lost Boys kennt“, schreibt Deng selbst im Vorwort, unterstreicht aber zugleich, dass die Welt, wie er sie erlebt habe, „sich nicht allzu sehr von der Welt unterscheidet, die auf diesen Seiten dargestellt wird“. Die Erzählung setzt mit einer Szene in Amerika ein. Deng öffnet einer Fremden die Tür zu seiner Wohnung in Atlanta. Die Frau, die vorgibt, wegen einer Autopanne telefonieren zu wollen, überfällt ihn zusammen mit einem Mann, Deng wird gefesselt und geknebelt. Während er, abermals zum wehrlosen Opfer einer Gewalttat geworden und abermals stumm gemacht, auf dem Boden liegt, stellt er sich vor, wie er seine Geschichte erzählt. Diese beginnt in einem südsudanesischen Dorf, in das der Krieg einbricht wie eine biblische Plage. Von dort aus führt die Flucht durch Wälder und Wüsten, durch Kenia und Äthiopien, und wenn der Erzähler zu Beginn äußert, was Gewalt angehe, gebe es nur wenig, was er dort nicht gesehen habe, so geben ihm die nachfolgenden Schilderungen barbarischer und häufig ebenso beiläufig verübter Gräuel recht.
Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, dass Eggers mehr will, als nur die Geschichte eines Menschen zu erzählen. Der Versuch, durch Literatur auf die Wirklichkeit, aus der sie gemacht ist, zurückzuwirken, prägt dieses Buch. Noch stärker als die beiden vorhergehenden Romane wirft es Haken aus, mit denen sich die Erzählung in der Realität jenseits der Seiten verankert. Hier ist der Roman Teil eines humanitären Projekts, denn aus dem Verkaufserlös finanziert Eggers eine Stiftung, die sich dem Wiederaufbau zerstörter Dörfer im Sudan widmet. Es ist keineswegs die einzige Initiative, mit der Eggers sich für gesellschaftliche Anliegen einsetzt. Eggers begnügte sich von Anfang an nicht damit, Bücher zu schreiben und diese dann an eine bestehende Infrastruktur weiterzugeben, er wollte den Markt auch verstehen und gestalten. Dem Gedanken, selbst ein Organ bereitzustellen, durch das er publizistisch tätig sein konnte, entsprang einst McSweeney’s. Der sensationelle Erfolg seines ersten Romans gestattete es bald, aus dem anfangs kleinen Magazin einen gleichnamigen Verlag aufzubauen, in dem Eggers Bücher bis heute erscheinen. Außerdem gibt er ein DVD-Filmjournal heraus und rief in San Francisco unter dem Namen 826 Valencia eine Schreibwerkstatt für Jugendliche ins Leben, die mittlerweile in New York, Seattle, Boston und Chicago Ableger hat – Eggers ist nicht nur Starautor, er ist auch Produzent, Unternehmer und Lehrer.
Solches Engagement verdient nicht nur Respekt, sondern auch Unterstützung und, wo möglich, Nachahmung. Doch bleibt im Falle von Weit gegangen die Frage nach der literarischen Qualität des Buches. Und weil die Pop-Musik-Vergleiche bei Eggers nahe liegen, lässt sich auch hier einer ziehen: Es besteht bei diesem Roman das U2-Problem. Er ist moralisch einwandfrei, engagiert, politisch korrekt, aber mitunter ist es dabei des Guten ein wenig zu viel. Dies liegt nicht daran, dass ein Autor sein Thema und seinen Stil verändert hat, sondern daran, dass im Zuge dessen etwas verloren gegangen zu sein scheint, was seine früheren Bücher auszeichnet, eine sprachliche Gewandtheit, die Frische seiner adoleszenzphilosophischen Betrachtungen, aufgrund derer Eggers auch nicht zu Unrecht mit Salingers Fänger im Roggen verglichen worden ist. Den Erlebnissen und Gefühlen von Valentino Achak Denk wäre dies natürlich nicht angemessen. Doch hier heißt es stattdessen etwa: „Das ist mir in Kakuma auch einmal passiert. Ich verlor jemanden, der mir sehr nahestand, und glaubte hinterher, ich hätte ihn retten können, wenn ich ein besserer Freund gewesen wäre. Aber jeder muss gehen, ganz gleich von wem er geliebt wird.“ Der Schrecken und das Schreckliche bleiben unbestreitbar, allerdings pressen sie sich dem Leser eher ins Gesicht als ins Bewusstsein. Die Balance zwischen Dengs eigener Stimme, die Eggers zusammen mit dem Erzählten wiedergeben will, und die Mittel desjenigen, der in Wirklichkeit schreibt, gelangen zu keiner sprachlich überzeugenden Synthese.
Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, legen früher oder später als Querschnitt ihres Werkes eine Best-of-Platte vor. Das gleiche gilt für Literaturzeitschriften. In The Best of McSweeney’s präsentiert Eggers eine Auswahl von Erzählungen, die in McSweeney’s zum ersten Mal erschienen sind. Von Eggers beiden letzten Büchern ist dies zumindest das abwechslungsreichere. Experimentierfreude ohne Kopflastigkeit, Trash-Kultur und Vorstadtrealismus stehen hier nebeneinander und geben ein Bild davon, welche Qualitäten sich in den amerikanischen Autorinnen und Autoren der jungen und mittleren Generation vereinen. Mit seinen eigenen Kurz- und Kürzestgeschichten über die Frage, was die Koreaner von den Deutschen halten oder wie sich das Wasser für die Fische anfühlt, befindet sich Eggers somit in bester Gesellschaft und erinnert daran, warum er selbst zu einer der wichtigsten und originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehört.
Andreas Martin Widmann
Dave Eggers: Ein herzzerreißendens Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius, 2000). Deutsch von Leonie von Reppert-Bismarck. KiWi TB 2006. 640 Seiten. 9,90 Euro.
Dave Eggers: Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity, 2002). Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. KiWi TB 2006. 496 Seiten. 12,95 Euro.
Dave Eggers: Weit gegangen. Das Leben des Valentino Achak Deng (What is the What, 2007). Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Kiepenheuer & Witsch 2008. 768 Seiten. 24,95 Euro.
Dave Eggers (Hrsg.): The Best of McSweeneys. Erzählungen von Dave Eggers, Zadie Smith, David Foster Wallace, A.M. Homes, Rick Moody, Jonathan Lethem und anderen. Übersetzt aus dem Englischen von Astrid Becker und Marion Kappel, Ulrich Blumenbach, Clara Drechsler und Harald Hellmann, Andrea Fischer, Susanne Goga-Klinkenberg, Frank Heibert, Ingo Herzke, Chris Hirte, Marcus Ingenday, Johann Maas, Friedhelm Rathjen, Nikolaus Stingl, Klaus Timmermann und Ulrike Wasel, Peter Torberg. Kiwi TB 2008. 304 Seiten. 12,95 Euro.
Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, werden früher oder später von Journalisten danach gefragt, wie der Name ihrer Band eigentlich zustande gekommen sei. „Wir haben uns nach einem Marmeladenrezept meiner Großmutter benannt“, sagen sie dann. Oder nach einer Gedichtzeile von William Blake. Oder dass sie keine Idee hatten und zehn Minuten vor dem ersten Auftritt auf gut Glück in ein Lexikon geschaut haben. Wichtiger als der Name ist, eine gute Geschichte erzählen zu können. Das gilt erst recht für Literaturzeitschriften. Als er selbst noch ein Kind war, berichtet Dave Eggers, erhielt seine Familie über mehrere Jahre hinweg immer wieder Post von einem Menschen, der schrieb, er sei ein Verwandter, und der in seinen Briefen seinen Besuch ankündigte. Er nannte sich Timothy McSweeney, gekommen ist er nie. Eggers erzählt diese Geschichte im Vorwort zu The Best of McSweeney’s. Als Name für eine Literaturzeitschrift bot sich der ominöse, ungeliebte Verwandte deshalb an, weil das Magazin als eine Art Asyl für Texte geplant war, die an anderer Stelle abgelehnt worden waren. Schon nach dem ersten Heft ging McSweeney’s jedoch dazu über, Originalbeiträge zu publizieren, von Autorinnen und Autoren wie Rick Moody, dem jüngst verstorbenen David Foster Wallace, von William T. Vollmann oder Nicole Krauss.
Die Idee zu McSweeney’s wurde geboren, während Eggers selbst noch an seinem ersten Roman schrieb und, wie er sagt, etwas suchte, um die Arbeit an dem Buch hinauszuschieben. Als es 2000 erschien, wirkte der Titel selbstbewusst, programmatisch und prophetisch: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität machte Eggers in den USA und in Europa auf Anhieb bekannt. Zusätzlich zum Verkaufserfolg brachte dieses Werk dem damals dreißigjährigen Autor auch eine Nominierung für den Pulitzerpreis ein. Eggers erzählt darin vom Tod seiner Eltern, die beide innerhalb weniger Wochen an Krebs starben, wie er selbst die Erziehung seines acht Jahre alten Bruders Toph übernahm und von den Jahren, in denen die beiden gemeinsam in Chicago, Kalifornien und New York lebten. Obschon die Erlebnisse fiktional überformt sind, trieb Eggers den Gestus des Autobiografischen so weit, dass er in der ersten Ausgabe Telefonnummern seiner Freunde abdrucken ließ. Entsprechend wurde das Buch von vielen nicht als Roman aufgenommen, sondern als Memoirenbuch. Den Anstrich des Authentischen und die damit einhergehende Rezeption karikiert jedoch das Foto des Autors auf einer der ersten Seiten. Eine leicht unscharfe Aufnahme zeigt einen jungen, dunkelhaarigen Mann in einem weißen T-Shirt. Auf seiner rechten Schulter sitzt ein Vogel, zwei Hundeköpfe flankieren ihn. Darunter ein paar Sätze zu seinem Leben, zuletzt heißt es, Eggers lebe mit seinem Bruder in Kalifornien und sie hätten keine Haustiere – der Leser soll bloß kein falsches Bild des Autorerzählers bekommen.
Das literarische Dokument einer Selbstfindung
Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität ist eine Coming-of-Age-Geschichte, das literarische Dokument einer Selbstfindung im Amerika der 1990er-Jahre und mit seiner exponierten Durchschnittsauthentizität nicht zuletzt ein Pendant zur MTV-Show „The Real World“, für die Eggers und die Mitarbeiter seiner ersten Independent-Zeitschrift Might sich ohne Erfolg bewarben. In den Nachwehen der literarischen Postmoderne hatte der Roman dabei eine neue, nicht artifiziell-vertrackte, sondern frische kompositorische Verspieltheit. Dort, wo das Kleingedruckte steht, das normalerweise kein Mensch liest, zwischen ISBN und Copyright-Erklärung, finden sich noch ein paar Angaben zum Verfasser sowie eine Skala zur Bestimmung seiner sexuellen Orientierung. Zwischen 1 für absolut hetero und 10 für absolut schwul stuft Eggers sich als 3 ein. Der eigentlichen Erzählung vorangestellt sind unter anderem eine unvollständige Liste mit Personen und Metaphern und ein langer Prolog, in dem Eggers Ratschläge für den Lektüregenuss des folgenden Werkes erteilt und auch Passagen nennt, die der Leser überspringen könne, ohne dadurch den Anschluss zu verlieren. Als Anhang präsentiert Eggers in der Taschenbuchausgabe noch einmal rund 50 Seiten mit gestrichenen Passagen, Korrekturen und allem Möglichen. Um diese zusätzlichen Passagen lesen zu können, muss man das Buch umdrehen, die Seiten sind – von vorne gesehen – auf dem Kopf stehend gedruckt.
In seinem nächsten Roman trieb Eggers dieses Spiel mit Möglichkeiten zur Erweiterung und Durchbrechung des Erzähltexts jedoch nicht noch weiter. Zwar beginnt Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind schon auf dem Buchdeckel, rein formal ist es im Vergleich mit dem Erstling dennoch fast konventionell. Im ersten Satz teilt der Erzähler mit, alles was folgt, hat sich ereignet, nachdem sein Freund Jack ums Leben kam und bevor er selbst mit 42 anderen Menschen, die er noch nicht kannte, in Kolumbien ertrank. Bei allen Mitteln, mit denen sich das Buch möglichen Genrezuordnungen widersetzt, ließe es sich doch als globale road novel bezeichnen. Um einmal rund um die Welt zu reisen, bleiben dem Ich-Erzähler Will Chmlielewski und seinem Begleiter Hand nur eine Woche. Anlass für dieses Unternehmen ist ein Haufen Geld – 32.000 Dollar, um genau zu sein –, die Will dafür erhalten hat, dass er für ein Glühbirnenwerbelogo Model gestanden hat und die er auf jeden Fall wieder loswerden will. Innerhalb von nur einer Woche fliegen die beiden deshalb in Zick-Zack-Routen um den Erdball, dabei einem eigenen Codex des Nicht-Umkehren-Dürfens folgend, und bringen amerikanische Dollars unter die Leute. Statt das Geld zu spenden oder auf profane Weise zu verschenken, kleben sie es mit Paketband an grasende Ziegen in Afrika. Der Zufall soll bestimmen, wem es zugute kommt, so wie Jacks Tod nichts weiter war als ein Zufall. Wie schon in Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität mischen sich der Tod und die Trauer immer wieder zwischen die komischen Episoden. Wills Aufbruch ist auch eine Flucht, weniger vor einem Ort oder einem Land als vor seinen eigenen Erinnerungen, vor den Gedanken an den Tod seines Freundes Jack, der in seinem Auto von einem Lastwagen überrollt worden ist.
Der einhellige Enthusiasmus, mit dem das erste Buch begrüßt wurde, konnte oder sollte sich nicht noch einmal einstellen. Galt die Detailversessenheit im ersten Buch als Beleg für Eggers Talent, Nichtigkeiten allein dank seiner stilistischen Brillanz zu literarischen Juwelen umschreiben zu können, wurde sie ihm nun als unnötig und nervtötend vorgehalten. Dabei war es nahe liegend, den Titel des ersten Romans aufzugreifen und zu konstatieren, Eggers sei dieses Mal weder genial noch umwerfend. Die Titel animieren aber nicht nur Rezensenten zu mancher euphorischen oder hämischen Bemerkung, sie sind überdies auch kaum übertragbar. Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius) hört sich an, als hätte das ein Dolmetschcomputer ausgespuckt, und auch Ihr werdet (noch) merken wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity) ist zwar auch weitgehend korrekt, klingt aber nicht sehr cool. Offenbar hat der deutsche Verlag es aufgegeben, nach wörtlichen Übersetzungen für sie zu suchen. Für die beiden in diesem Jahr zeitgleich erschienenen Bände hat man sich dagegen darauf besonnen, was im Kino üblicherweise gemacht wird: gar keine Übersetzung oder ein ganz anderer Titel. Es blieb bei The Best of McSweeney’s und What Is the What heißt auf Deutsch Weit gegangen.
Der Roman als Teil eines humanitären Projekts
Handlung des Romans ist das nicht unangemessen. Auf mehr als 700 Seiten erzählt Eggers die wahre Geschichte von Valentino Achak Deng, eines sudanesischen Flüchtlings, der nach einer traumatisierenden Odyssee in die USA gelangt ist. Mit diesem dritten Roman wendet sich Eggers zugleich der oral history zu, die in der afroamerikanischen Literatur durch die slave narratives eine wichtige Tradition hat. Führte im 19. Jahrhundert noch für viele Schwarze der Weg von Afrika nach Amerika in die Sklaverei, so sind die USA für Achak Deng und viele seiner Landsleute das Land, in dem sie Asyl, aber keine Heimat finden. „Ich kam hierher, viertausend von uns kamen hierher, und wir erhofften und erwarteten Ruhe. Frieden, eine Ausbildung und Sicherheit.“ Diese Erwartungen werden enttäuscht, statt aufs College zu gehen, muss Deng Aushilfsjobs annehmen. Die Flüchtlinge leben als Schatten in dieser Gesellschaft und es fehlt ihnen eine Stimme, die ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung Gehör verschafft. Dave Eggers hat deshalb seine eigene angeboten. So ist seine Erzählung des Lebens des Valentino Achak Deng auch ein Roman. Das Buch solle daher „nicht als verbindliche Geschichte des Bürgerkriegs im Sudan oder des sudanesischen Volkes verstanden werden, nicht mal als die meiner Brüder, die man als die Lost Boys kennt“, schreibt Deng selbst im Vorwort, unterstreicht aber zugleich, dass die Welt, wie er sie erlebt habe, „sich nicht allzu sehr von der Welt unterscheidet, die auf diesen Seiten dargestellt wird“. Die Erzählung setzt mit einer Szene in Amerika ein. Deng öffnet einer Fremden die Tür zu seiner Wohnung in Atlanta. Die Frau, die vorgibt, wegen einer Autopanne telefonieren zu wollen, überfällt ihn zusammen mit einem Mann, Deng wird gefesselt und geknebelt. Während er, abermals zum wehrlosen Opfer einer Gewalttat geworden und abermals stumm gemacht, auf dem Boden liegt, stellt er sich vor, wie er seine Geschichte erzählt. Diese beginnt in einem südsudanesischen Dorf, in das der Krieg einbricht wie eine biblische Plage. Von dort aus führt die Flucht durch Wälder und Wüsten, durch Kenia und Äthiopien, und wenn der Erzähler zu Beginn äußert, was Gewalt angehe, gebe es nur wenig, was er dort nicht gesehen habe, so geben ihm die nachfolgenden Schilderungen barbarischer und häufig ebenso beiläufig verübter Gräuel recht.
Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, dass Eggers mehr will, als nur die Geschichte eines Menschen zu erzählen. Der Versuch, durch Literatur auf die Wirklichkeit, aus der sie gemacht ist, zurückzuwirken, prägt dieses Buch. Noch stärker als die beiden vorhergehenden Romane wirft es Haken aus, mit denen sich die Erzählung in der Realität jenseits der Seiten verankert. Hier ist der Roman Teil eines humanitären Projekts, denn aus dem Verkaufserlös finanziert Eggers eine Stiftung, die sich dem Wiederaufbau zerstörter Dörfer im Sudan widmet. Es ist keineswegs die einzige Initiative, mit der Eggers sich für gesellschaftliche Anliegen einsetzt. Eggers begnügte sich von Anfang an nicht damit, Bücher zu schreiben und diese dann an eine bestehende Infrastruktur weiterzugeben, er wollte den Markt auch verstehen und gestalten. Dem Gedanken, selbst ein Organ bereitzustellen, durch das er publizistisch tätig sein konnte, entsprang einst McSweeney’s. Der sensationelle Erfolg seines ersten Romans gestattete es bald, aus dem anfangs kleinen Magazin einen gleichnamigen Verlag aufzubauen, in dem Eggers Bücher bis heute erscheinen. Außerdem gibt er ein DVD-Filmjournal heraus und rief in San Francisco unter dem Namen 826 Valencia eine Schreibwerkstatt für Jugendliche ins Leben, die mittlerweile in New York, Seattle, Boston und Chicago Ableger hat – Eggers ist nicht nur Starautor, er ist auch Produzent, Unternehmer und Lehrer.
Solches Engagement verdient nicht nur Respekt, sondern auch Unterstützung und, wo möglich, Nachahmung. Doch bleibt im Falle von Weit gegangen die Frage nach der literarischen Qualität des Buches. Und weil die Pop-Musik-Vergleiche bei Eggers nahe liegen, lässt sich auch hier einer ziehen: Es besteht bei diesem Roman das U2-Problem. Er ist moralisch einwandfrei, engagiert, politisch korrekt, aber mitunter ist es dabei des Guten ein wenig zu viel. Dies liegt nicht daran, dass ein Autor sein Thema und seinen Stil verändert hat, sondern daran, dass im Zuge dessen etwas verloren gegangen zu sein scheint, was seine früheren Bücher auszeichnet, eine sprachliche Gewandtheit, die Frische seiner adoleszenzphilosophischen Betrachtungen, aufgrund derer Eggers auch nicht zu Unrecht mit Salingers Fänger im Roggen verglichen worden ist. Den Erlebnissen und Gefühlen von Valentino Achak Denk wäre dies natürlich nicht angemessen. Doch hier heißt es stattdessen etwa: „Das ist mir in Kakuma auch einmal passiert. Ich verlor jemanden, der mir sehr nahestand, und glaubte hinterher, ich hätte ihn retten können, wenn ich ein besserer Freund gewesen wäre. Aber jeder muss gehen, ganz gleich von wem er geliebt wird.“ Der Schrecken und das Schreckliche bleiben unbestreitbar, allerdings pressen sie sich dem Leser eher ins Gesicht als ins Bewusstsein. Die Balance zwischen Dengs eigener Stimme, die Eggers zusammen mit dem Erzählten wiedergeben will, und die Mittel desjenigen, der in Wirklichkeit schreibt, gelangen zu keiner sprachlich überzeugenden Synthese.
Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, legen früher oder später als Querschnitt ihres Werkes eine Best-of-Platte vor. Das gleiche gilt für Literaturzeitschriften. In The Best of McSweeney’s präsentiert Eggers eine Auswahl von Erzählungen, die in McSweeney’s zum ersten Mal erschienen sind. Von Eggers beiden letzten Büchern ist dies zumindest das abwechslungsreichere. Experimentierfreude ohne Kopflastigkeit, Trash-Kultur und Vorstadtrealismus stehen hier nebeneinander und geben ein Bild davon, welche Qualitäten sich in den amerikanischen Autorinnen und Autoren der jungen und mittleren Generation vereinen. Mit seinen eigenen Kurz- und Kürzestgeschichten über die Frage, was die Koreaner von den Deutschen halten oder wie sich das Wasser für die Fische anfühlt, befindet sich Eggers somit in bester Gesellschaft und erinnert daran, warum er selbst zu einer der wichtigsten und originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehört.
Andreas Martin Widmann
Dave Eggers: Ein herzzerreißendens Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius, 2000). Deutsch von Leonie von Reppert-Bismarck. KiWi TB 2006. 640 Seiten. 9,90 Euro.
Dave Eggers: Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity, 2002). Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. KiWi TB 2006. 496 Seiten. 12,95 Euro.
Dave Eggers: Weit gegangen. Das Leben des Valentino Achak Deng (What is the What, 2007). Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Kiepenheuer & Witsch 2008. 768 Seiten. 24,95 Euro.
Dave Eggers (Hrsg.): The Best of McSweeneys. Erzählungen von Dave Eggers, Zadie Smith, David Foster Wallace, A.M. Homes, Rick Moody, Jonathan Lethem und anderen. Übersetzt aus dem Englischen von Astrid Becker und Marion Kappel, Ulrich Blumenbach, Clara Drechsler und Harald Hellmann, Andrea Fischer, Susanne Goga-Klinkenberg, Frank Heibert, Ingo Herzke, Chris Hirte, Marcus Ingenday, Johann Maas, Friedhelm Rathjen, Nikolaus Stingl, Klaus Timmermann und Ulrike Wasel, Peter Torberg. Kiwi TB 2008. 304 Seiten. 12,95 Euro.
... comment
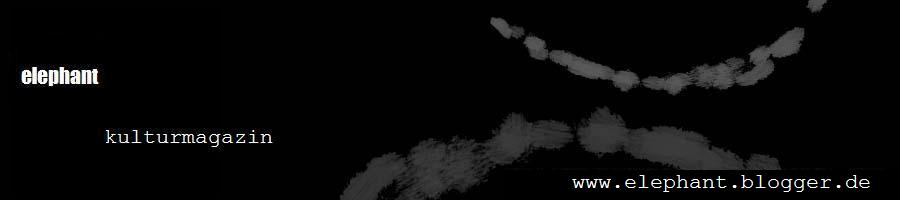 kulturmagazin
kulturmagazin