Dienstag, 21. Oktober 2008
Ingo Schulze. Unverklärter Zugriff auf die Wirklichkeit. Portrait
elephant, 17:37h

Eine schwer zu beseitigende Pauschalweisheit der Buch- und Verlagsbranche besagt, Kurzgeschichten fänden keine Leser. Auf welches Wissen sich diese Weisheit eigentlich stützt, ist unklar, doch ob es wirklich Absatzzahlen sind, scheint mindestens fragwürdig. Ein handelsüblicher Erzählungsband verkauft sich, könnte man meinen, nicht grundsätzlich schlechter als ein handelsüblicher Roman, der sich in aller Regel auch nicht gut verkauft.
Wenn Bestsellerlisten auffallend wenige Kurzgeschichtensammlungen verzeichnen, könnte dies also schlicht damit zusammenhängen, dass weniger gedruckt werden. Entsprechend selten kommt es heute vor, dass ein deutschsprachiger Autor mit Kurzprosa debütiert. Zu den bemerkenswertesten Ausnahmen von dieser Regel gehört Ingo Schulze. Geboren 1962 in Dresden, studierte er Altgriechisch, Latein und Germanistik in Jena und arbeitete dann zwei Jahre als Dramaturg am Altenburger Theater. Nach 1989 gründete er in Altenburg eine Zeitung und ging 1993 als Redakteur eines kostenlosen Anzeigenmagazins nach St. Petersburg. „Lebt mit Frau und zwei Töchtern in Berlin“, heißt es nüchtern auf seiner Homepage. Das Foto darüber zeigt ihn mit Brille, langem, lockigem Haar, den Mund zu einem Lächeln geschürzt.
33 Augenblicke des Glücks, Schulzes erstes Buch, erschien 1995 und war nicht nur deshalb unkonventionell, weil es sich um Erzählungen handelte. Schulze verarbeitete darin seine eigenen Beobachtungen im postkommunistischen Russland und Erfahrungen aus dieser Zeit literarisch, und zwar nicht, indem er nach einer „authentischen unverwechselbaren Stimme“ suchte, sondern er reagierte, wie er selbst sagt, „mit Hilfe vornehmlich russischer und sowjetischer Literatur auf eine Situation“ – indem er also vorgefundene Stimmen erprobte. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in Piter, so lautet der Untertitel des Buches – Schulze tritt nicht als Autor auf, sondern als Herausgeber. Prompt wiesen Rezensenten seinerzeit darauf hin, es herrsche in diesem Buch kein einheitlicher Ton und der Autor dieser Geschichten habe offenbar seine eigene Stimme noch nicht gefunden. Worin die Kritik einen Mangel erkennen wollte, war jedoch die vom Autor bewusst gewählte Methode, die darin besteht, im Dialog mit dem jeweiligen Thema für einen Text den ihm angemessenen Stil zu suchen.
In Simple Storys behielt Schulze diese Methode bei, doch war es hier nur die Stimme eines Vorbildes, die er sich leihen wollte: die des Amerikaners Raymond Carver. Carvers knapper, von ornamentalem Sprachgebrauch und Pathos völlig freier Stil eröffnete einen angemessenen Zugriff auf die Wirklichkeit Ostdeutschlands nach dem Mauerfall, die Schulze in Simple Storys erzählend beschreibt. Abermals handelt es sich bei den Texten um Kurzgeschichten, geschrieben in geradezu klassischer Manier, wie schon der Titel nahe legt. Wenige Jahre zuvor hatte Robert Altman in Short Cuts eine Reihe von Carver-Storys auf die Leinwand gebracht. In Altmans Drehbuch kreuzen sich die Wege einzelner Figuren aus an sich unzusammenhängenden Geschichten, sodass sich ein neues, komplexes Handlungsgewebe ergibt. Schulzes genialer Kunstgriff in Simple Storys besteht darin, dass er diese Kompositionstechnik übernimmt und seine Kurzgeschichten auf diese Weise zu Kapiteln macht, die im Ganzen die Genrebezeichnung Roman völlig rechtfertigen. So ergeben die Episoden ein (Sitten)Gemälde der ostdeutschen Provinz, in der die programmatische Einfachheit und Alltäglichkeit der Geschichten das Lebensgefühl nach der Euphorie wiedergibt, ohne sich darüber zu erheben.
Döblin als Pate für das eigene poetologische Selbstverständnis
Schulze hat wiederholt sein eigenes Schreiben dahingehend charakterisiert, dass der Stoff über die Form und den Stil bestimmt, in die der literarische Text gebracht wird, und er hat sich mit diesem poetologischen Selbstverständnis ausdrücklich auf Alfred Döblin berufen. Dass Neue Leben (2004) (Zur TITEL-Rezension), der Roman, an dem Schulze mehr als sechs Jahre arbeitete, als Briefroman konzipiert ist – und damit ein altmodisch anmutendes Genre aufgreift –, erklärt sich somit aus dem Thema und aus Schulzes Verfahren. „In dem Moment, in dem mir klar wurde, dass die Hauptfigur jemand ist, der in der DDR immer geschrieben hat und davon träumte, Schriftsteller zu werden – denn niemand war ja so wichtig wie ein Schriftsteller – und der mit dem Mauerfall seine literarische Karriere für beendet erklärt, weil er merkt, das ist nicht mehr relevant, ganz andere Dinge werden jetzt interessant, in dem Moment brauchte ich ein Medium, in dem diese Figur trotzdem noch schreiben kann. Er konnte immerhin noch Briefe schreiben”, so Schulze im Gespräch mit Uta Beiküfner. Ähnlich wie Simple Storys wurde Neue Leben. Die Jugend Enrico Türmers in Briefen und Prosa herausgegeben, kommentiert und mit einem Vorwort versehen von Ingo Schulze von der Kritik zum lange ersehnten Wenderoman erklärt. Schulze selbst, der neuerlich in die Rolle des Herausgebers schlüpfte, avancierte damit in der öffentlichen Wahrnehmung endgültig zum Autor der Wiedervereinigung, die er aus ostdeutscher Sicht erzählte.
Es ist eine Sicht, die Schulze selbst nicht geographisch definiert, sondern weiter fasst: „Die Ostperspektive ist, von der Tendenz her, die des Neulings, des Dazugekommenen, der das Vorhandene nie so im kleinen Finger haben wird wie jemand, der schon immer da gewesen ist. Man hat aber auch ganz andere Erfahrungen gemacht und wundert sich über manches, das jemandem, der im Westen aufgewachsen ist, als völlig normal, vielleicht sogar als naturgegeben erscheint.“ Mit dieser Perspektive hat Schulze auch die Hauptfiguren seines jüngsten Romans Adam und Evelyn (2008) ausgestattet. Adam ist Mitte dreißig und in der DDR ein gefragter Damenschneider. Evelyn, seine Frau, ist Anfang zwanzig und studiert. Als sie Adam im Sommer 1989 in einer unzweideutigen Situation mit einer seiner Kundinnen ertappt, verlässt sie ihn und bricht mit einer Freundin in Richtung Ungarn auf. Adam folgt den beiden in seinem alten, liebevoll gepflegten Wartburg 311 und mit seiner Schildkröte Elfi, die er in einem Schuhkarton transportiert. Ohne es ursprünglich gewollt zu haben, gerät auch er so in die Umbruchswirren. Nachdem Ungarn seine Grenzen zum Westen geöffnet hat, will Evelyn nicht wieder zurück. Adam bleibt widerwillig bei ihr. Nach allerlei amourösen Verwicklungen, in denen die Aufbruchsstimmung und die politische Lage der Vorwendezeit die Bindungen aufhebt und die Regeln des Zusammenlebens außer Kraft setzt wie der Karneval, kommen die beiden wieder zu einander. In einem Hotelzimmer in Österreich finden sie eine Bibel in der Nachttischschublade. Noch in dem Glauben, ein anderer Gast müsse sie dort vergessen haben, liest Adam seiner Frau schließlich daraus vor.
„‚Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben.’ – ‚Des Todes?’ – ‚Ich denk, du hast das gelesen?’ – ‚Aber wieso denn des Todes? Ich dachte, die müssen nur aus dem Paradies raus?’ – ‚Das ist doch dasselbe.’ – ‚Weil sie im Paradies nicht sterben?’ – ‚Ja, natürlich.’“
War Simple Storys hinsichtlich der Handlungskomposition an die Erzählweise des Films angelehnt, so liest sich Adam und Evelyn über weite Strecken wie ein Drehbuch. Dialoge nehmen den größten Raum ein, die narrativen Passagen sind reduziert und so gewinnt der Text die Leichtigkeit einer opera buffa. Gerade Adam fällt es jedoch nicht leicht, im Westen Fuß zu fassen. Es gibt keinen Markt für Damenschneider und er, der eigentlich gar nicht weg wollte, muss schließlich in einer Änderungsschneiderei arbeiten. Die Flucht, die durch den Mauerfall nachträglich ihren Wert einbüßt wie das Ostgeld, wird für ihn dadurch zu einer Vertreibung aus dem Paradies. Am Ende, als eine neue Existenz für beide greifbar wird, kippt der leichte, komödienhafte Ton. Wie die plötzliche Einsicht in die eigene Sterblichkeit, lässt Schulze in den letzten Sätzen die Bedrohung durch die Zukunft aufscheinen. „Die Elster hüpfte weiter über die kahlen Äste und Zweige der Kastanie und wippte dabei hin und her als würde sie in jedem Augenblick das Gleichgewicht verlieren. Die Lampe spiegelte sich in der Scheibe. Darunter erkannte Evelyn sich selbst und um sich herum das ganze Zimmer, das noch viel größer schien als in Wirklichkeit, beinahe riesig, und direkt in dessen Mitte sah sie, klein und farbig, ihr eigenes Bild.“
Protokolle der Veränderung – ohne Verklärung, ohne Nostalgie
Schulze betrachtet die Vergangenheit nicht mit den Augen der Verklärung, sondern allenfalls mit denen eines melancholischen Protokollanten. In seinem Essay Damals in der Provinz beschreibt er, wie der kulturelle Wert eines Buches in der DDR gerade danach taxiert werden konnte, wie leicht oder schwer es aufzutreiben war, weshalb ihm gerade die Buchhandlungen auf dem Land häufig Glückserlebnisse bescherten. Dergleichen ist mit dem Wegfall der Zensur ebenfalls verschwunden. „Die Literatur hat sich aus dem flachen Land zurückgezogen in wenige urbane Oasen – und Antiquariate. Außerhalb derer existiert sie nur virtuell im Computer – wie ein Otto-Bestellcenter, exterritorial wie die großen Tankstellen – beeindruckender Service immerhin“, bemerkt Schulze. Ohne je in Nostalgie zu verfallen, registrieren auch seine Romane und Erzählungen die Veränderungen der Zeit, die gesellschaftlichen und die technischen, aber auch die Werteverschiebungen, die damit einhergehen. Die Einsicht etwa, dass viele Geschichten aus Simple Storys anders verlaufen wären, wenn die Figuren ein Handy besessen hätten, bewog Schulze, das Mobiltelefon, in dem das Wesen der Nachmillenniums-Gesellschaft sinnfällig wird, zum Leitmotiv seines 2006 erschienenen Erzählungsbandes Handy (Zur Titel-Rezension)zu machen. Obwohl der Untertitel programmatisch Dreizehn Geschichten in alter Manier ankündigt, hat er sich, das sei nur nebenbei erwähnt, nicht schlecht verkauft.
Wenn Schulzes Weg als Autor auch mit einem Missverständnis begann, wird er von Seiten der Kritik spätestens seit seinem zweiten Buch Simple Storys (1998) mit einer erstaunlichen Einmütigkeit gelobt. Erstaunlich, weil sie sonst selten vorkommt, nicht weil das Lob unberechtigt wäre. Simple Storys gehört mittlerweile zum Kanon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und auch die Preise, die Schulze erhalten hat – nach dem aspekte-Preis, dem Joseph-Breitbach-Literaturpreis, dem Peter-Weiss-Preis und einigen mehr stand er in diesem Jahr, zum zweiten Mal bereits, auf der short-list für den Deutschen Buchpreis – können sich sehen lassen. Aber Schulze hat es nicht dabei bewenden lassen, sich ehren zu lassen und sich artig zu bedanken. Er hat sich getraut, das Preiswesen selbst zu kritisieren und deutlich zu machen, dass er sich als Autor sein Selbstverständnis nicht von vermeintlichen Erwartungen des Marktes und des so genannten Literaturbetriebs diktieren lässt. So nahm er die Überreichung des Thüringer Literaturpreises im Winter 2007 zum Anlass, auf die weiterreichende gesellschaftliche Problematik hinzuweisen, die mit der Finanzierung staatlicher Preise durch Wirtschaftsunternehmen einhergeht und er hat dafür Worte gefunden, die in ihrer Deutlichkeit bei einem offiziellen Anlass wie der besagten Preisverleihung selten sind:
„Mich stört, dass wir dabei sind, das aufzugeben, was in einem langen Prozess erkämpft worden ist, nämlich dass der demokratische Staat seine Verantwortung wahrnimmt, nicht nur für die Künste. Mich stört, dass es kaum noch einen Ausstellungskatalog gibt ohne das Logo oder den Namen einer Firma, beinah jedes Festival oder Gastspiel gibt zu Beginn die Liste seiner Sponsoren bekannt. Selbst der Empfang der deutschen Botschaft in Rom zum Tag der Einheit wurde mit dem Dank an eine Autofirma eröffnet, deren Produkte wie Karyatiden den Eingang schmückten. Sie alle kennen Beispiele aus ihrem Alltag. Diese Refeudalisierung ist bereits zur Selbstverständlichkeit verkommen. Deshalb könnte man meinen, die Zustände in vielen deutschen Alters- und Pflegeheimen sind deshalb so erschreckend, weil es den Verantwortlichen nicht gelungen ist, Sponsoren zu aufzutreiben.“
Schulze nennt auch Ross und Reiter, wenn er erklärt: „Das heißt, mich stört, dass ich über E.ON nachdenken muss, wenn ich den Thüringer Literaturpreis annehmen will.“
Den Preis hat Schulze angenommen, das Geld aber dem Land Thüringen zur Verfügung gestellt, um einen eigenen Literaturpreis zu initiieren. Die Resonanz, die seine Rede in den Feuilletons erfuhr, zeigt, dass er einen Nerv getroffen hat. Dass seiner Entscheidung für die Kurzgeschichte ähnliche Wirkung zuteil wird, ist zu wünschen. Unlängst hat Dave Eggers schon angedroht, in Deutschland die Kurzgeschichte notfalls mit militärischen Maßnahmen durchzusetzen. Bis dahin wäre die Lektüre von Schulzes Erzählungen ein probates und in jedem Falle empfehlenswertes Mittel.
Andreas Martin Widmann
... comment
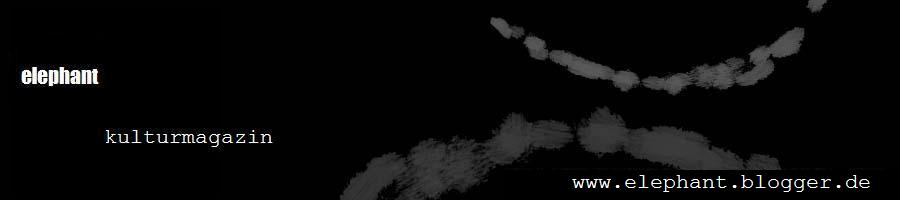 kulturmagazin
kulturmagazin