Montag, 23. Juni 2008
Ein anderes Alaska - Michael Chabons "Die Vereinigung jidischer Polizisten"
elephant, 16:09h
„Seit neun Monaten haust Landsman nun im Hotel Zamenhof, ohne dass es einem seiner Mitbewohner gelungen wäre, sich umbringen zu lassen. Jetzt hat jemand dem Gast von Zimmer 208 eine Kugel in den Kopf gejagt, einem Jid, der sich Emanuel Lasker nannte.“ Für den Polizisten Meyer Landsman, der in Zimmer 505 lebt, bedeutet dieser Mord drei Stockwerke tiefer eine willkommene Abwechslung in seiner dienstfreien Zeit, die er seit seiner Scheidung üblicherweise schlafend und trinkend zubringt. Doch kaum hat ihn das Verbrechen aus seiner Lethargie gerissen, überschlagen sich die Ereignisse für Landsman, seinen Kollegen und Kumpel Berko und für seine Ex-Frau Bina Gelbfish, die seit kurzem Landsmans Vorgesetzte ist. Nachdem die Identität des Toten geklärt ist, häufen sich die Hinweise darauf, dass dieser – Mendel Shpilman, Sohn eines chassidischen Lehrers – vor seinem Absturz in die Heroinsucht nicht nur als außergewöhnlich talentierter Schachspieler von sich reden gemacht hat, sondern sogar als ein neuer Messias verehrt worden ist. Schon bald gibt es noch mehr Tote und weil einige davon auf Landsmans Rechnung gehen, wird ihm sein Dienstausweis entzogen. Das einzige, was ihm bleibt, ist seine abgegriffene Mitgliedskarte der Vereinigung jiddischer Polizisten und so nimmt er auf eigene Faust die Spur des Verbrechens auf, die ihn weiter in den Norden Alaskas führt. Dort war Shpilman kurz Patient einer Entzugsklinik, dort werden Kühe mit seltsamem Fell gezüchtet und auch das Personal des obskuren Sanatoriums erweist sich als äußerst schlagkräftig.
„1948: seltsame Zeiten für Juden. Im August brach die Verteidigung von Jerusalem zusammen, und die zahlenmäßig unterlegenen Juden der drei Monate alten Republik Israel wurden verjagt, massakriert, ins Meer getrieben.“ Selbst wer den Verweis auf einen Veteranen des Kubakriegs auf der ersten Seite des Romans übersehen hat, reibt sich wohl an dieser Stelle die Augen, bevor er ein paar Sätze weiter liest, dass die 1948 aus Israel vertriebenen Juden eine auf sechzig Jahre befristete Siedlungslizenz in einem Teil Alaskas erhielten. Damit ist klar, dass die politische Landkarte, die Chabon in seinem Roman zeichnet, deutlich von der Erfahrungswirklichkeit der Leser abweicht. Die Geschichtswissenschaft bezeichnet entsprechende Gedankengebäude als kontrafaktische Überlegungen. Spätestens seit Robert Harris’ Bestseller Vaterland, in dem eine Welt, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, den Hintergrund für eine Kriminalhandlung abgibt, haben solche kontrafaktischen Geschichtsdarstellungen besonders in der populären Literatur Konjunktur.
Kontrafaktische Vision und faszinierendes Spiel mit literarischen Vorlagen
Chabon macht für die Erzählhandlung seines Romans eine historische Fußnote zum Aufhänger: Den 1938 von dem amerikanischen Politiker Harold Ickes eingebrachten Vorschlag, Alaska als rettenden Hafen für europäische Juden zu öffnen. Aus der fiktiven historischen Weichenstellung ergibt sich in Chabons Roman ein alternativer Geschichtsverlauf, innerhalb dessen der Zweite Weltkrieg erst 1946 endet, und zwar mit der Zerstörung Berlins durch nukleare Waffen. Was Die Vereinigung jiddischer Polizisten von trivialeren Produkten des Genres abhebt, ist zunächst die Art und Weise, in der die Kriminalhandlung auf den kontrafaktischen historischen Hintergrund bezogen ist, denn der Mordfall und das Schicksal der Juden in Alaska hängen enger zusammen als Landsman und der Leser anfangs ahnen können. Und so erscheint im Falle von Die Vereinigung jiddischer Polizisten der Vergleich mit Philip Roth näher liegend als der mit Robert Harris, denn auch Roths Verschwörung gegen Amerika machte unlängst das Schicksal der Juden unter veränderten historischen Umständen zum Thema eines Romans. Den Anstoß zu Die Vereinigung jiddischer Polizisten gaben Chabon die Reaktionen auf einen Essay, den er unter dem Titel A Guidebook to a Land of Ghosts über einen jiddischen Reisesprachführer aus dem Jahr 1958 geschrieben hatte. In welchem Land der Welt, so Chabons Frage, könne ein solches Buch seinen Zweck erfüllen, nachdem Israel ein und für allemal dem Jiddischen den Rücken gekehrt und die Sprecher dieser Sprache zu einer aussterbenden Spezies geworden seien? Seine traurige und pessimistische Diagnose trug ihm zahlreiche Vorwürfe ein und rief mit seinem Roman wiederum eine literarische Antwort hervor. Dieser entwirft eine eigene Version eines solchen Landes, doch das von Chabon geschilderte Alaska, in dem Jiddisch Amts- und Umgangssprache ist, ist keine zionistische Utopie, sondern ein Provisorium, dessen Verfallsdatum zum Greifen nahe ist. Und so lässt sich Chabons Werk auch als fiktionale Interpretation eines historischen Sachverhalts und als Kommentar zur nicht enden wollenden Debatte um das Existenzrecht Israels lesen.
Bei alledem ist Die Vereinigung jiddischer Polizisten jedoch auch ein faszinierendes Spiel mit unzähligen Motiven und literarischen Vorlagen. Chabons Ermittlerfigur ist ein hard-boiled detective, in der Tradition Dashiell Hammetts und Raymond Chandlers stehend, und auch sprachlich sind die Reminiszenzen an Chandler unverkennbar. Eine Figur wird vorgestellt als „ein riesiges auseinandergelaufenes Dessert, ein Comichaus mit geschlossenen Fenstern, in dem der Wasserhahn aufgedreht wurde“, eine andere trägt „eine Brille, wie sie alternde britische Rockgitarristen gerne in nachdenklichen Interviews zur Schau stellen“. Zusammen mit den jiddischen Einsprengseln entwickelt sich so ein eigener Erzählton, ein Strom aus kunstvollen Wortbildern, der den Leser durch das Buch trägt – durch ein Buch, dessen Handlung immer wieder von Neuem überraschen kann und das sich in einem Tag und einer Nacht herunterlesen lässt, ohne dass nachher ein schales Gefühl zurückbliebe.
von Andreas Martin Widmann
--------------------------------------------------------------------------------
Michael Chabon: Die Vereinigung jiddischer Polizisten (The Yiddish Policemen’s Union, 2007) Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer. Kiepenheuer & Witsch 2008. 422 Seiten. 19,95 Euro.
„1948: seltsame Zeiten für Juden. Im August brach die Verteidigung von Jerusalem zusammen, und die zahlenmäßig unterlegenen Juden der drei Monate alten Republik Israel wurden verjagt, massakriert, ins Meer getrieben.“ Selbst wer den Verweis auf einen Veteranen des Kubakriegs auf der ersten Seite des Romans übersehen hat, reibt sich wohl an dieser Stelle die Augen, bevor er ein paar Sätze weiter liest, dass die 1948 aus Israel vertriebenen Juden eine auf sechzig Jahre befristete Siedlungslizenz in einem Teil Alaskas erhielten. Damit ist klar, dass die politische Landkarte, die Chabon in seinem Roman zeichnet, deutlich von der Erfahrungswirklichkeit der Leser abweicht. Die Geschichtswissenschaft bezeichnet entsprechende Gedankengebäude als kontrafaktische Überlegungen. Spätestens seit Robert Harris’ Bestseller Vaterland, in dem eine Welt, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, den Hintergrund für eine Kriminalhandlung abgibt, haben solche kontrafaktischen Geschichtsdarstellungen besonders in der populären Literatur Konjunktur.
Kontrafaktische Vision und faszinierendes Spiel mit literarischen Vorlagen
Chabon macht für die Erzählhandlung seines Romans eine historische Fußnote zum Aufhänger: Den 1938 von dem amerikanischen Politiker Harold Ickes eingebrachten Vorschlag, Alaska als rettenden Hafen für europäische Juden zu öffnen. Aus der fiktiven historischen Weichenstellung ergibt sich in Chabons Roman ein alternativer Geschichtsverlauf, innerhalb dessen der Zweite Weltkrieg erst 1946 endet, und zwar mit der Zerstörung Berlins durch nukleare Waffen. Was Die Vereinigung jiddischer Polizisten von trivialeren Produkten des Genres abhebt, ist zunächst die Art und Weise, in der die Kriminalhandlung auf den kontrafaktischen historischen Hintergrund bezogen ist, denn der Mordfall und das Schicksal der Juden in Alaska hängen enger zusammen als Landsman und der Leser anfangs ahnen können. Und so erscheint im Falle von Die Vereinigung jiddischer Polizisten der Vergleich mit Philip Roth näher liegend als der mit Robert Harris, denn auch Roths Verschwörung gegen Amerika machte unlängst das Schicksal der Juden unter veränderten historischen Umständen zum Thema eines Romans. Den Anstoß zu Die Vereinigung jiddischer Polizisten gaben Chabon die Reaktionen auf einen Essay, den er unter dem Titel A Guidebook to a Land of Ghosts über einen jiddischen Reisesprachführer aus dem Jahr 1958 geschrieben hatte. In welchem Land der Welt, so Chabons Frage, könne ein solches Buch seinen Zweck erfüllen, nachdem Israel ein und für allemal dem Jiddischen den Rücken gekehrt und die Sprecher dieser Sprache zu einer aussterbenden Spezies geworden seien? Seine traurige und pessimistische Diagnose trug ihm zahlreiche Vorwürfe ein und rief mit seinem Roman wiederum eine literarische Antwort hervor. Dieser entwirft eine eigene Version eines solchen Landes, doch das von Chabon geschilderte Alaska, in dem Jiddisch Amts- und Umgangssprache ist, ist keine zionistische Utopie, sondern ein Provisorium, dessen Verfallsdatum zum Greifen nahe ist. Und so lässt sich Chabons Werk auch als fiktionale Interpretation eines historischen Sachverhalts und als Kommentar zur nicht enden wollenden Debatte um das Existenzrecht Israels lesen.
Bei alledem ist Die Vereinigung jiddischer Polizisten jedoch auch ein faszinierendes Spiel mit unzähligen Motiven und literarischen Vorlagen. Chabons Ermittlerfigur ist ein hard-boiled detective, in der Tradition Dashiell Hammetts und Raymond Chandlers stehend, und auch sprachlich sind die Reminiszenzen an Chandler unverkennbar. Eine Figur wird vorgestellt als „ein riesiges auseinandergelaufenes Dessert, ein Comichaus mit geschlossenen Fenstern, in dem der Wasserhahn aufgedreht wurde“, eine andere trägt „eine Brille, wie sie alternde britische Rockgitarristen gerne in nachdenklichen Interviews zur Schau stellen“. Zusammen mit den jiddischen Einsprengseln entwickelt sich so ein eigener Erzählton, ein Strom aus kunstvollen Wortbildern, der den Leser durch das Buch trägt – durch ein Buch, dessen Handlung immer wieder von Neuem überraschen kann und das sich in einem Tag und einer Nacht herunterlesen lässt, ohne dass nachher ein schales Gefühl zurückbliebe.
von Andreas Martin Widmann
--------------------------------------------------------------------------------
Michael Chabon: Die Vereinigung jiddischer Polizisten (The Yiddish Policemen’s Union, 2007) Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer. Kiepenheuer & Witsch 2008. 422 Seiten. 19,95 Euro.
... comment
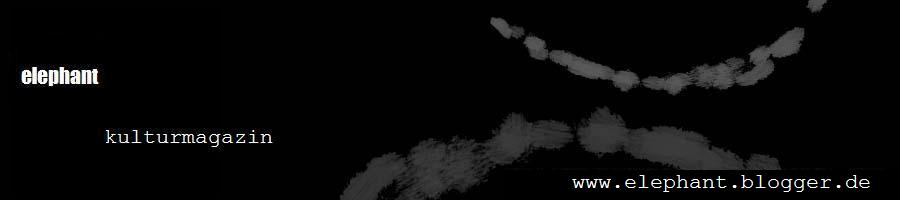 kulturmagazin
kulturmagazin