Montag, 9. Juni 2008
Gegrillte Meerschweinchen? Portrait: Santiago Roncagliolo
elephant, 16:59h

Nach der Lesung hat sich eine Schlange am Büffet gebildet und diejenigen unter den Gästen, die sich schon ein Rezensionsexemplar von Roter April geholt haben, müssen nun einen Weg finden, mit nur zwei Händen möglichst ungezwungen Buch, Teller und Glas festzuhalten. „Vielleicht gibt es wirklich auch gegrilltes Meerschweinchen, so wie im Roman“, sagt ein junger Herr zu seiner Begleitung. Aber wir sind nicht in Peru, sondern in Frankfurt am Main und Meerschweinchen als Fingerfood, das würde zweifellos das sittliche und kulinarische Empfinden der Gäste verletzen, die an diesem noch winterlich kalten Märzabend der Einladung des Verlags gefolgt sind. Es bleibt bei Pisco Sour, Chicken Wings und Kartoffelgratin. „Eigentlich schade“, sagt jemand, „Gott sei Dank“, befindet eine ältere Dame. Der Autor, dessen Romanfigur Felix Chacaltana diese im Globetrotterjargon auch als „Andendöner“ apostrophierte Spezialität häufiger verzehrt, steht nicht weit entfernt mit ein paar Buchhändlern und Journalisten zusammen. Er trägt Jeans, ein schwarzes Hemd und eine dunkelgerahmte Brille. Er redet, lacht, gestikuliert. Und er scheint mehr als zwei Hände zu haben.
Exil
Santiago Roncagliolo, 1975 in Lima geboren, schreibt seit seinem 22. Lebensjahr Erzählungen und Romane für Erwachsene und Kinder, Theaterstücke und Drehbücher, außerdem arbeitet er als Journalist und Übersetzer. Sein Vater verließ als Anhänger der Revolutionären Sozialistischen Partei wie viele Linke in dieser Zeit das Land und nahm seine Familie mit sich. Mexiko bot ein Refugium für Exilanten und so wuchs Roncagliolo unter Gleichaltrigen aus zahlreichen lateinamerikanischen Ländern auf, in denen ihre Eltern bedroht oder verfolgt wurden. Bei seiner Rückkehr nach Peru in den 1980er Jahren fand er dort eine veränderte gesellschaftliche und politische Situation vor. Das Land erlebte den Höhepunkt der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und dem Sendero Luminoso. Jene wohl wirkungsmächtigste Terrorgruppe Lateinamerikas stürzte Peru im Namen der sozialistischen Revolution in einen regelrechten Bürgerkrieg, der auf beiden Seiten insgesamt 70.000 Tote forderte, grob geschätzt, denn verlässliche Zahlen sind kaum zu ermitteln. Viele der Opfer waren Bauern, Analphabeten, die häufig keinen Pass besaßen und dadurch für das Auge der Bürokratie nicht existierten. „Für die meisten Kinder in meinem Alter schien das normal, sie kannten ja nichts anderes. Aber ich war entsetzt. Zu dieser Zeit begann ich zu lesen. Vermutlich bot die Literatur mir eine bessere Welt als die Wirklichkeit. Außerdem war das eine Beschäftigung, zu der man nicht das Haus verlassen musste“, sagt Roncagliolo. Als Student in Lima fing er an, selbst zu schreiben, zunächst ausschließlich für sich selbst. Seine ersten Versuche hielt er unter Verschluss, weil er die akademischen Leser fürchtete, von denen er umgeben war, doch die Tätigkeit des Schreibens begeisterte ihn so sehr, dass er entschied, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. So verfasste er Texte für jeden Anlass der sich bot: Journalistische Beiträge, Seifenopern, Theatertexte und politische Ansprachen und erwarb sich auf diesem Weg das Handwerk des Schreibens.
Realität
Wer in seinen Büchern einem Nachhall der äußeren, politischen Krise des Landes, die für Roncagliolo eine innere, persönliche Krise mit sich brachte, nachspürt, wird in Matías y los imposibles (2006; dt: Matthias und die Unmöglichen), fündig. Es ist die Geschichte eines Jungen, der seine Freunde nicht in der Realität, sondern in der Phantasie findet. Die Erzählung nimmt ein Thema auf, das Roncagliolo schon in der Erzählungssammlung Crecer es un oficio triste (2003; dt: Großwerden ist ein trauriges Geschäft) gestaltete, nämlich die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und was dazu gehört: Die Entdeckung der Liebe, der Sexualität und der eigenen Persönlichkeit.
Neben der universellen Traurigkeit des Heranwachsens, sind es die konkreten Kennzeichen der peruanischen Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung, die in Roncagliolos Büchern ihren Niederschlag finden – das Nebeneinander von Wohlstand und extremer Armut in Lima, die Randexistenz der Indios in den Provinzen und das Gespenst der eigenen Geschichte, das diese Gesellschaft mit sich herumträgt. Der Terrorismus, seine Auswirkungen und seine Hinterlassenschaften tauchen in Roncagliolos Werk immer wieder auf. La cuarta espada (2007, dt. Das vierte Schwert), ist ein Buch über den Anführer des „Leuchtenden Pfads“ Abimael Guzmán, den Roncagliolo als „eine Art Intellektuellen des Terrors“ charakterisiert und dessen Portrait er in der Tradition der non-fiction novel zeichnet, für die Truman Capote mit In Cold Blood das Modell lieferte. Abril rojo, ein Roman, an dem Roncagliolo zeitgleich arbeitete und der in diesem Jahr auf Deutsch unter dem Titel Roter April erschienen ist, leistet dagegen eine fiktionale Auseinandersetzung mit dem Thema. „Es gibt keinen Terrorismus mehr“ – diesen Worten eines Militärkommandanten möchte der stellvertretende Bezirkstaatsanwalt Felix Chacaltana nicht recht glauben, als er aus Lima in seine Heimatstadt Ayacucho zurückversetzt wird und als nach den Ausschweifungen des Karnevals eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche gefunden wird. Dennoch schreibt Chacaltana, auf Druck seiner Vorgesetzten, einen Bericht, aus dem hervorgeht, der Tote habe sich im Rausch selbst angezündet. Um seine vorbildliche Aufklärungsarbeit zu belohnen, schickt man Chacaltana als nächstes in ein Andendorf, wo er den ordnungsgemäßen Ablauf der Präsidentschaftswahlen zu beaufsichtigen hat. Und wieder gerät er in Konflikt mit Vertretern des Militärs, denn die toten Hunde an den Laternen und die Feuer, die nachts in den Bergen im Zeichen von Hammer und Sichel brennen, passen nicht mit den Beteuerungen zusammen, der Terrorismus sei besiegt und ein abgeschlossenes historisches Kapitel. Chacaltana stellt auf eigene Faust Nachforschungen an und je weiter die Kreise werden, die seine Ermittlungen ziehen, desto undurchsichtiger werden für ihn die einmal stabil geglaubten Werte, bis letztlich auch die Unterscheidung zwischen Gut und Böse unmöglich wird.
Krieg und Frieden und Literatur
Fast drei Jahre lang hat Roncagliolo nach seinem Sprach- und Literaturwissenschafts- studium der Universidad Católica in Lima für eine peruanische Menschenrechtsorganisation gearbeitet und mit Angehörigen von Opfern des Bürgerkriegs gesprochen. „Irgendwann reduzierte sich der Unterschied zwischen Gut und Böse für mich darauf zu entscheiden, welche Mörder mir lieber waren“, sagt er im Interview. In Roter April erzählt Roncagliolo von Menschen, deren Gegenwart die Vergangenheit ist, und davon, wie deren Leben gerade deshalb von den Toten bestimmt wird, weil die Vergangenheit tot geschwiegen wird. „Niemand wollte davon sprechen. Weder die Militärs noch die Polizisten, noch die Zivilbevölkerung. Sie hatten die Erinnerung an den Krieg gemeinsam mit seinen Opfern begraben. Chacaltana dachte, dass die Erinnerung an die achtziger Jahre wie die stumme Erde von Friedhöfen war. Das einzige, was alle teilen, das einzige, worüber niemand spricht“, heißt es einmal. Viele der Dialoge im Roman basieren auf Zitaten und Protokollen, ebenso seien die Schilderungen der Angriffsmethoden des Leuchtenden Pfads und die Beschreibungen der Strategien zur Bekämpfung so genannter subversiver Elemente, von Folter und Verschwinden von Personen real, liest man in einem Nachtrag zu Roter April und begreift, dass auch in diesem Buch die Fiktion über weite Strecken nicht so sehr Erfindung als Abbild der Wirklichkeit ist.
Die verstümmelte Leiche, die angstvolle Verstocktheit der Dorfbevölkerung, das zynische und despotische Auftreten des Militärs, all das erinnert an die Romane Wer hat Palomino Molero umgebracht? und Tod in den Anden von Roncagliolos berühmten Landsmann Mario Vargas Llosa. Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass Roncagliolo einer anderen Generation von Autoren angehört. Der Boom, den die lateinamerikanische Literatur seit den 1960er Jahren erlebte ist vorbei, und auch die Gleichsetzung dieser Generation und der lateinamerikanischen Literatur mit dem Magischen Realismus. Roncagliolos sprachlicher Zugriff auf die Realität ist direkt, mitunter bewusst protokollarisch im Ton: „Lucy ging um 12:25 Uhr aus dem Haus, nachdem sie sich sorgfältig, aber dezent geschminkt hatte“ – so eröffnet Roncaglio ein Kapitel seines ersten Romans Vorsicht (2004, dt. 2006). Paul Valerys berühmt gewordene Absage an das traditionelle Erzählen – man könne keinen Satz mehr schreiben wie „Die Marquise verließ das Haus um fünf Uhr“, weil dies zu trivial sei, soll dieser einmal zu André Breton gesagt haben – ist für Roncagliolo, anders als für die Boom-Autoren, die durchaus Anschluss an die europäische Moderne suchten, kein Maßstab mehr. Sein Verfahren zeichnet sich dadurch aus, die Dinge beim Namen zu nennen. Dennoch ist er nicht festgelegt auf die Wiedergabe dessen, was an der Oberfläche sichtbar ist, sondern er sucht nach literarischer Spiegelung der Erfahrungswirklichkeit und ihrer Wahrnehmung. Die Welt ist durch die Augen seiner Figuren gesehen, selbst wenn es sich um einen Kater handelt. In Vorsicht gehört das Haustier der Familie Ramos, von der der Roman erzählt, zum Figurenensemble und dieser Kater tritt nicht nur als Akteur, sondern auch als eigenwilliger Beobachter und Interpret des Geschehens auf. Er liefert einen eigenen, zusätzlichen Blick auf das Innenleben dieser Familie, in der Sergio, der Jüngste, Gespenster sieht, die Mutter Lucy sich zu Treffen mit einem unsichtbaren Briefschreiber davonstiehlt, während der Großvater in ein Seniorenheim eindringt, um einer ehemaligen Geliebten nahe zu sein und der Vater Alfredo eine passende Gelegenheit sucht, den anderen von seiner Krebserkrankung zu berichten.
Die Verfilmung des Romans lief letztes Jahr in spanischen Kinos und bereits der Text bedient sich insofern einer filmischen Erzählweise, als er das Geschehen aus den wechselnden Perspektiven von Angehörigen dieser Mittelstandsfamilie aus Lima wie Einstellungen eines Episodenfilms aneinanderfügt. Sowenig wie in Roter April die Anklänge an David Finchers Film Sieben zufällig sind, ist in Vorsicht das Echo von Ang Lees Der Eissturm bloße Einbildung. Nach Einflüssen und Vorbildern befragt, räumt Roncagliolo diese freimütig ein und nennt Fincher und Lee ausdrücklich, neben John Cheever (Vorsicht), Antonio Tabucchi (Roter April) und anderen, selbstverständlich. „Es ändert sich mit jedem neuen Buch“, antwortet er.
… und Multimedia
Am ehesten kennzeichnet wohl das Miteinander von Buch, Film und Internet Roncagliolos Schreiben. Sein eigenes Drehbuch Extraños (2001) wurde mit dem Petrobras-Preis ausgezeichnet und in Brasilien verfilmt. Während einer Lesereise durch mehrere Kontinente führte er in seinem Blog ein online-Tagebuch, das wiederum unter dem Titel Jet Lag (2007) in Buchform erschienen ist. Dabei bestimmen das Thema und die Geschichte, die er erzählen möchte, über die literarischen Mittel. Roncagliolo bewegt sich zwischen den Genres und den Sparten des Buchmarktes hin und her. Vorsicht verknüpft Gesellschaftsdurchleuchtung mit Unterhaltung, Roter April nutzt Muster des Politthrillers zur Auseinandersetzung mit einem nationalen Trauma. Bei dieser Variabilität pflegt Roncagliolo eine Art mittlerer Stillage, in der das was erzählt wird, wichtiger erscheint, als die Wörter, die dazu gebraucht werden. Mit solchen Autoren tut sich die deutsche Literaturkritik traditionell eher schwer, doch an diesem Abend in Frankfurt ist von derartigen Verständnisschwierigkeiten nichts zu spüren. Es sieht alles danach aus, als werde sich der internationale Erfolg Roncagliolos in Deutschland fortsetzen. Der Bücherstapel ist kein Stapel mehr und um halb elf hat sich die Schlange der Gäste längst vom Büffet weg verlagert, hin zu Santiago Roncagliolo, der die Bücher signieren soll. Er tut es lächelnd, noch immer redend, geduldig, mehrhändig.
Andreas Martin Widmann
Santiago Roncagliolo: Roter April. (Abril rojo). Aus dem Spanischen von Angelica Ammar. Suhrkamp 2008.
... comment
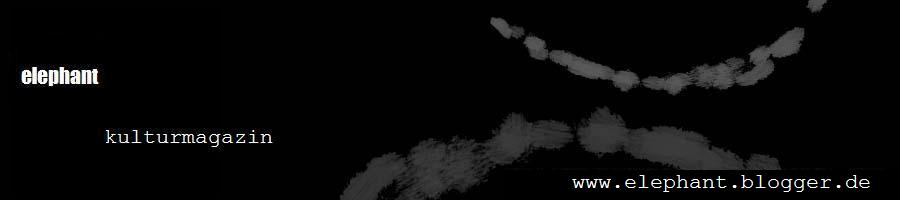 kulturmagazin
kulturmagazin